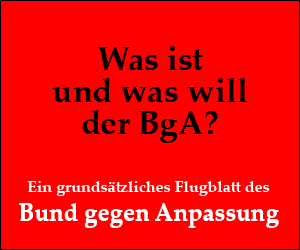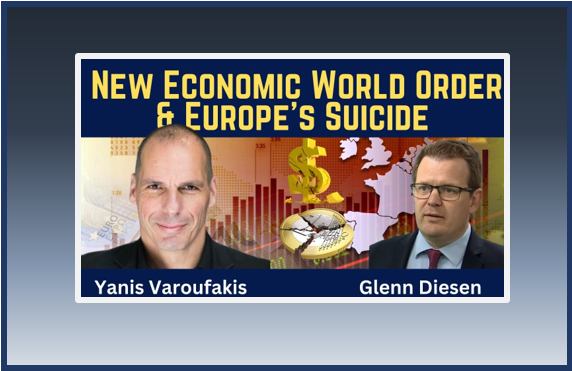Die Debatte um den digitalen Euro wird nun schärfer geführt: Die neueste PwC-Studie spricht davon, dass auf Europas Banken enorme Kosten zukommen, sollte tatsächlich die digitale Zentralbankwährung eingeführt werden. Die Europäische Zentralbank hat jedoch erhebliche Zweifel an der Berechnung geäußert und geht mit der Studie hart ins Gericht, weil man politische Motive vermutet.
Warum die PwC-Studie unter Beschuss steht
Eine neue Analyse des Wirtschaftsprüfers PwC hat für beträchtliche Diskussionen gesorgt. Nach Angaben der von Bankenverbänden beauftragten Studie könnte die Einführung des digitalen Euro nämlich Kosten von bis zu 30 Milliarden Euro verursachen. Dabei bezieht sich die Summe vor allem auf technische Anpassungen: angefangen von Banking Apps über Geldautomaten bis hin zu Zahlungsterminals. Die Nachrichtenagentur dpa veröffentlichte die Zahlen, die zudem auch gleich von Warnungen der beteiligten Verbände begleitet wurden, die hier bereits von einem massiven finanziellen Kraftakt sprechen.
Doch inzwischen hat sich der Wind etwas gedreht. Laut einem Bericht des „Handelsblatts“ hält die Europäische Zentralbank die Berechnungen für deutlich überzogen. So spricht die EZB von methodischen Unschärfen, von nicht ausreichend geprüften Daten und wenig tragfähigen Annahmen. Die Kritiker vermuten sogar, dass das Papier auch ein Gefälligkeitsgutachten sein könnte, das den ohnehin bestehenden Widerstand vieler Institute gegen den digitalen Euro stützen soll.
Dass die Studie innerhalb der Bankenwelt nicht unumstritten ist, das hat sich recht schnell gezeigt. Der Branchenblog „Finanz-Szene“ berichtete unter anderem von internen Differenzen und Kritik an der Herangehensweise. Besonders heikel ist zudem auch, dass PwC gerade einmal 19 Banken befragt hat und daraus eine europaweite Kostenprojektion abgeleitet wurde. Dass diese Zahlen später von Bankenverbänden offensiv kommuniziert wurden, obwohl intern sehr wohl Zweifel bestanden haben, hat die Kritik natürlich verschärft.
Was Banken am digitalen Euro wirklich fürchten
Während Sparkassen (DSGV) und Genossenschaftsbanken (BVR) die Studie genutzt haben, um auf die angeblich gewaltigen Kosten und einen „nicht erkennbaren Mehrwert“ hinzuweisen, haben die privaten Banken hingegen deutlich zurückhaltender reagiert. Sie nannten öffentlich gerade einmal eine Untergrenze von 18 Milliarden Euro. Auch das zeigt klar auf, wie unterschiedlich die Interessen innerhalb der Branche sind.
Den Instituten geht es natürlich nicht nur um IT-Ausgaben. Hinter der Ablehnung steckt auch ein strategischer Konflikt. Denn die Banken haben Sorge, dass die Bürger digitale Euros künftig direkt bei der Zentralbank halten könnten. Das würde dann in weiterer Folge die klassischen Einlagenstrukturen unter Druck setzen und die Refinanzierung der Institute gefährden. Die EZB will diese Sorgen entschärfen und hat bereits angekündigt, dass das Guthaben pro Person begrenzt werden soll. Im Gespräch ist ein Limit von rund 3.000 Euro. Damit will man verhindern, dass in Krisenzeiten massenhaft Guthaben in digitale Zentralbankkonten abwandern. Gleichzeitig betonte die EZB aber auch, dass die Kontoführung weiterhin über Banken und Zahlungsdienstleister und nicht über die Notenbank selbst laufen soll.
Interesse an digitalen Währungen ist größer geworden
Abseits des digitalen Euros ist das Interesse an Bitcoin und Co. gestiegen. Wurden Kryptowährungen vor Jahren noch von Seiten der Banken belächelt, so gibt es heute immer mehr Institute, die hier selbst Produkte in diese Richtung anbieten. Aber Bitcoin und Co. sind nicht nur Spekulationsobjekte oder bieten eine Form der langfristigen Veranlagung. Sie sind auch Zahlungsmittel. Besonders beliebt sind Kryptowährungen in den Bereichen Online Gaming und Online Glücksspiel. Die besten Casinos ohne OASIS akzeptieren in der Regel Bitcoin. Die Transaktion mit der Kryptowährung ist sicher und schnell, zudem bleibt man anonym. Es finden sich weder Hinweise am Bankkonto, noch auf der Kreditkartenabrechnung. Auch die Zahl der Online Shops, die Kryptowährungen akzeptieren, ist über die letzten Jahre stark gestiegen.
Abseits der Thematik rund um die Kosten gibt es noch einen weiteren Punkt, der die Branche beschäftigt: die Rolle großer Technologieunternehmen. Der BVR warnte in diesem Zusammenhang, etwa von internationalen Tech-Konzernen, die dann „unbeabsichtigt gestärkt“ werden könnten, weil die neue digitale Infrastruktur dann für einen leichteren Zugang zum europäischen Zahlungsverkehr sorgen könnte. Am Ende würde Europa ein zentrales System schaffen und amerikanische Anbieter profitieren.
In diesem Punkt argumentierte die EZB aber mit digitaler Souveränität. Sie sieht nämlich im digitalen Euro die Chance, dass die Abhängigkeit von US Anbietern wie Mastercard, Visa oder PayPal verringert werden könnte. Auch die Bundesbank hat bereits betont, dass die neue Form des Zentralbankgelds das Bargeld nicht ersetzen kann, sondern ergänzen soll.
Wie es nun mit dem digitalen Euro weitergeht
Unabhängig von der Diskussion setzt die EZB ihre Vorbereitungen fort. Einerseits definiert man gerade die technische Architektur, andererseits arbeitet die EU-Kommission an der rechtlichen Grundlage. Frühestens ab dem Jahr 2027 könnte die digitale Währung dann tatsächlich eingeführt werden.
Wie hoch am Ende die tatsächlichen Kosten ausfallen, bleibt weiterhin offen. Klar ist vorerst nur, dass die prognostizierten Beträge inzwischen deutlich hinterfragt werden. Die Debatte über den digitalen Euro wird damit weiter an Schärfe gewinnen.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
 POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung