Glücksspiel ist ein milliardenschwerer Markt, der sich zunehmend ins Digitale verlagert. Damit entstehen Herausforderungen, die nach klaren gesetzlichen Vorgaben verlangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz existieren entsprechende Regelungen, allerdings fällt auf, wie unterschiedlich diese im Detail gestaltet sind. Während das eine Land staatliche Strukturen zementiert, versucht das nächste, mit föderaler Abstimmung Schritt zu halten. Und im dritten Fall sind es die Kantone, die für bemerkenswerte Eigenheiten sorgen.
Ein einheitliches Modell für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ist nicht in Sicht und das, obwohl wirtschaftliche Verflechtungen, kulturelle Nähe und ein gemeinsamer Sprachraum durchaus Anlass dafür geben könnten. Wodurch sich diese Unterschiede erklären lassen, welche Konsequenzen sie haben und weshalb eine Harmonisierung aktuell kaum realistisch wirkt, zeigt dieser Beitrag.
Föderale Spielregeln, staatliche Monopole und kantonale Eigenwege – drei Länder, drei Modelle
Schon bei der grundlegenden Struktur der Glücksspielregulierung verlaufen die Linien in völlig verschiedene Richtungen. Deutschland hat sich nach langem juristischem Ringen auf den Glücksspielstaatsvertrag von 2021 geeinigt. Dieser erlaubt Online-Casinos, virtuelle Automatenspiele sowie Online-Poker, jedoch dürfen Spieler nur unter klaren Auflagen mit echtem Geld einzahlen, dazu zählen ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro, ein Maximaleinsatz von einem Euro pro Dreh bei Automatenspielen und die Einbindung in das zentrale Sperrsystem OASIS. Zuständig für die Aufsicht ist die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, die sowohl Genehmigungen erteilt als auch Verstöße verfolgt.
In Österreich sieht die Ausgangslage völlig anders aus. Dort wird der Glücksspielmarkt durch ein staatliches Monopol kontrolliert, das nahezu ausschließlich von der Casinos Austria AG betrieben wird. Andere Anbieter haben kaum Chancen auf Zulassung. Selbst Plattformen mit Lizenzen aus EU-Staaten stoßen regelmäßig auf juristische Hürden und politische Ablehnung. Eine Öffnung des Marktes wird zwar immer wieder diskutiert, hat bislang jedoch keine strukturellen Veränderungen bewirkt.
Die Schweiz geht einen dritten Weg. Seit Inkrafttreten des Geldspielgesetzes im Jahr 2019 dürfen nur solche Unternehmen ein Online-Angebot betreiben, die bereits eine Konzession für ein landbasiertes Casino besitzen. Der digitale Markt bleibt dadurch klein und überschaubar. Für die Umsetzung zahlreicher Regelungen sind allerdings die Kantone zuständig, was zu erheblichen Unterschieden bei Werbung, Jugendschutz oder Aufklärungspflichten führt. Einheitlich ist das Ergebnis nicht, funktionsfähig bleibt es dennoch.
Keine verbindliche EU-Linie – Europa bleibt beim Glücksspiel zurückhaltend
In vielen Bereichen hat die Europäische Union für einheitliche Regeln gesorgt. Beim Glücksspiel jedoch bleibt sie auffällig still. Die Dienstleistungsfreiheit innerhalb des Binnenmarkts gilt zwar grundsätzlich auch in diesem Sektor, wird aber in der Praxis oft durch nationale Ausnahmeregeln eingeschränkt. Schließlich geht es um sensible Themen wie Spielsuchtprävention, Jugend- und Verbraucherschutz oder ethische Wertvorstellungen sind alles Bereiche, in denen sich die Mitgliedsstaaten ihre Souveränität nicht aus der Hand nehmen lassen.
Der Europäische Gerichtshof hat dieses Vorgehen wiederholt gestützt. Nationale Einschränkungen gelten als legitim, solange sie nachvollziehbar begründet sind und konsequent umgesetzt werden. Einheitliche EU-Richtlinien, die für alle gelten würden, existieren nicht. Stattdessen gibt es unverbindliche Empfehlungen und politische Papiere, deren rechtlicher Einfluss begrenzt bleibt.
Nationale Eigenlogiken statt internationaler Einheit – ein Blick auf die historischen Wurzeln
Die heutige Vielfalt bei der Regulierung ist nicht aus Versehen entstanden. Vielmehr handelt es sich um das Ergebnis historisch gewachsener Strukturen, die bis heute nachwirken. In Deutschland lag die Zuständigkeit für Glücksspiele über Jahrzehnte hinweg bei den Bundesländern. Der erste Staatsvertrag von 2008 sollte das ändern, führte aber zu einem unübersichtlichen System, in dem beispielsweise Schleswig-Holstein mit einer Sonderregelung eigene Lizenzen vergab. Erst der Glücksspielstaatsvertrag von 2021 brachte zumindest auf dem Papier eine Vereinheitlichung, wenn auch nicht ohne Spannungen im Detail.
In Österreich dominierte von Anfang an ein staatsnahes Modell. Das Monopol der Casinos Austria ist fest im Gesetz verankert und eng mit politischen Interessen verknüpft. Reformen verlaufen zäh, da sie nicht nur rechtliche, sondern auch wirtschaftliche und institutionelle Hürden überwinden müssten.
Die Schweiz folgt konsequent ihrem föderalen Prinzip. Die Kantone behalten zahlreiche Kompetenzen, und auch das nationale Geldspielgesetz hat daran wenig verändert. Vieles wird lokal entschieden. Das ist ein Ansatz, der zwar weniger zentralistisch wirkt, aber nicht zwangsläufig ineffizient sein muss.
Spielerschutz, Zulassungen und Zugangskontrollen
Bei der Frage, wie Spielende geschützt werden sollen, setzt Deutschland auf ein technisches und juristisches Kontrollsystem, das umfassend wirkt. OASIS erlaubt zentrale Sperren für gefährdete Personen, sei es durch Selbstsperrung oder durch die Initiative von Dritten. Dazu kommen Einzahlungslimits, verpflichtende Identitätsprüfungen und strenge Vorgaben für Werbung. Diese Maßnahmen gelten ausnahmslos für alle lizenzierten Anbieter.
In Österreich existieren zwar Ansätze für Spielerschutz, jedoch fehlt ein vergleichbares System. Die Möglichkeit zur Selbstsperre besteht in der Regel nur auf Ebene der einzelnen Anbieter. Ein zentrales Register existiert bislang nicht. Auch bei den Werberichtlinien und Präventionsmaßnahmen zeigt sich eine gewisse Zurückhaltung bei der Umsetzung verpflichtender Standards.
Die Schweiz verlangt von ihren lizenzierten Betreibern, dass Sperrfunktionen angeboten und regelmäßig aktualisiert werden. Die Sperrlisten werden teilweise untereinander weitergegeben. Darüber hinaus existieren kantonale Vorschriften zur Zusammenarbeit mit Beratungsstellen oder zur Schulung des Personals. Das ist ein System, das stark vom jeweiligen Wohnort abhängig ist und dadurch regional sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Anbieter im regulatorischen Hürdenlauf – warum die Lizenzvergabe unterschiedlich geregelt ist
In Deutschland entscheidet die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder darüber, ob ein Anbieter eine Lizenz erhält. Der Prozess ist aufwendig, erfordert umfangreiche Nachweise in technischer, finanzieller und rechtlicher Hinsicht und endet für viele mit Ablehnung. Wer die Bedingungen erfüllt, darf allerdings legal am Markt teilnehmen und genießt Rechtssicherheit.
In Österreich sieht die Lage weniger offen aus. Der Markt wird faktisch durch das staatliche Monopol kontrolliert. Lizenzen für private Anbieter sind praktisch nicht vorgesehen. Selbst Unternehmen mit EU-Zulassung stoßen regelmäßig auf gesetzliche Schranken, da österreichische Gerichte die nationale Rechtslage in diesem Punkt konsequent durchsetzen.
Die Schweiz beschränkt den Zugang zum Online-Markt auf bereits bestehende Betreiber stationärer Casinos. Nur wer über eine landbasierte Spielbank verfügt, erhält eine Konzession für ein Online-Angebot. Der Markt bleibt dadurch klein, die Übersichtlichkeit hoch. Anbieter ohne Genehmigung landen auf Sperrlisten, die über DNS-Blockierungen durchgesetzt werden.
Gemeinsame Regulierung – denkbar in der Theorie, unwahrscheinlich in der Praxis
Eine einheitliche Regelung für den Glücksspielmarkt in der DACH-Region wäre durchaus realisierbar, zumindest technisch betrachtet. Politisch jedoch fehlt der Wille zur Koordination. Zu unterschiedlich sind die Systeme, zu tief verwurzelt die nationalen Modelle und zu widersprüchlich die wirtschaftlichen Interessen.
Denkbar wären punktuelle Kooperationen, etwa bei der Bekämpfung illegaler Angebote, bei technischen Standards oder bei der gegenseitigen Anerkennung von Sperrsystemen. Auch neue Technologien wie automatisierte Risikobewertungen, Blockchain-Identifikation oder KI-basierte Monitoring-Tools könnten künftig eine Rolle spielen.
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.


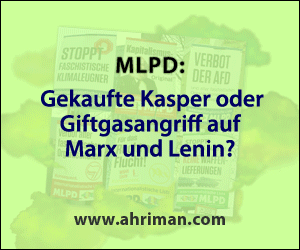

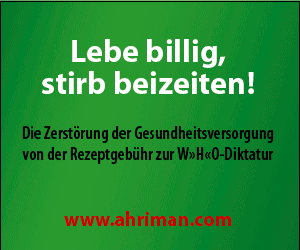






Erwin Geschonneck (* 27. Dezember 1906 in Bartenstein, Kreis Friedland, Ostpreußen; † 12. März 2008 in Berlin) war ein deutscher Schauspieler. Seine größten Erfolge erlebte er in der DDR, wo er als einer der gefragtesten und profiliertesten Darsteller galt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Geschonneck
Der Lotterieschwede
.
Der Lotterieschwede ist eine deutsche Literaturverfilmung der DEFA von Hans Joachim Kunert aus dem Jahr 1958 nach der gleichnamigen Novelle des dänischen Schriftstellers Martin Andersen Nexö.
.
Die einsame dänische Ostseeinsel Bornholm im Jahr 1880 ist grau und kalt. Hier fristet der Steinbrucharbeiter Johan Jönnson mit seiner Frau und den Kindern ein armseliges Leben. Selbst die Mitarbeit seines Sohnes im Steinbruch reicht nicht aus, um erträglich leben zu können. In seiner Not hofft Johan auf ein Lotterielos und dessen Gewinn, um seine Lebensverhältnisse aufzubessern. Da es sich hierbei um ein Serienlos handelt, wird er vom Verkäufer genötigt, immer wieder ein neues zu kaufen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Lotterieschwede
Glücksspiele sollten überhaupt verboten werden. Zu viele Leichtgläubige verlieren ihre Ersparnisse und Haltlose, Faulpelze und Nichtsnutze werden verführt.
Jedes Land kann doch seine eigenen SPIELSÜCHTIGEN in die ABHÄNGIGLKEIT von SPIELHÖLLEN treiben, eine Gemeinsamkeit mehrerer Länder benötigen sie nicht dafür. Auch die Verschuldung des SPIELERS scheint dem kassierenden STAAT eine FREUDE zu sein !
Und die ganzen Süchte müssen dann die Zahler der angeblichen sozialen Sicherungssysteme bezahlen-.
Die Kosten für Süchtige , wie Alkohol, Drogen, Tabak, Medikamenten usw. werden nicht von den KK veröffentlicht, denn dann würde selbst der dümmste Michel die Zahlungen einstellen.
Und alle diese Systeme sind als „Zwang“
“ eingeführt worden und damit ist da der Korruption und der Betrügerei Tür und Tor geöffnet worden!